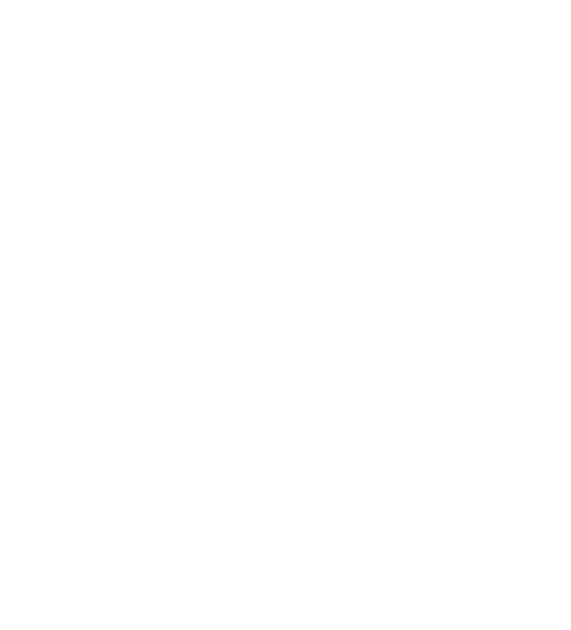Die “Aufbereitungsvalidierung” – Definition, Verfahren und Prüfungen gemäß DIN EN ISO 17664 bzw. DIN EN ISO 17665
Der häufig fälschlicherweise verwendete Begriff „Aufbereitungsvalidierung” bezieht sich in diesem Kontext auf die Validierung von Herstelleranleitungen zur Aufbereitung wiederverwendbarer Medizinprodukte. Die Begrifflichkeiten „Reinigungsvalidierung“ und „Aufbereitungsvalidierung“ werden umgangssprachlich sehr oft vermischt. Zu beachten ist jedoch, dass es sich dabei um grundsätzlich verschiedene Themen handelt. Bei der Reinigungsvalidierung wird die Wirksamkeit der Endreinigung nach der Herstellung überprüft (siehe Blog “Die Reinigungsvalidierung”). Bei der „Validierung der Aufbereitung“ wird hingegen das in der Herstelleranleitung beschriebene Aufbereitungsverfahren wiederverwendbarer Medizinprodukte validiert.
Die sichere Wiederverwendung von Medizinprodukten ist ein zentraler Bestandteil der Patientensicherheit. Durch die Validierung der Aufbereitungsverfahren gemäß DIN EN ISO 17664-1/-2 bzw. DIN EN ISO 17665 wird gewährleistet, dass die vom Hersteller angegebenen Prozesse zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation wirksam und reproduzierbar sind. Dabei spielt das akkreditierte Prüflabor eine entscheidende Rolle bei der Prüfung der beschriebenen Verfahren unter akkreditierten und überwachten Laborbedingungen. In diesem Whitepaper werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Nutzen für Patienten, die Risikobewertung durch den Hersteller und die typischen Prüfverfahren im Labor erläutert.
Gesetze und Normen
EU-Medizinprodukteverordnung (MDR 2017/745): Hersteller müssen für wiederverwendbare Medizinprodukte detaillierte Aufbereitungsanweisungen bereitstellen und deren Wirksamkeit validieren.
DIN EN ISO 17664-1/-2: Legt fest, welche Informationen der Hersteller zur Aufbereitung liefern muss (Reinigung, Desinfektion, Sterilisation, Trocknung, Inspektion, Verpackung, Lagerung).
DIN EN ISO 17665: Legt die Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Dampf-Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte fest
Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV, §8): Die Aufbereitung muss mit geeigneten, validierten Verfahren erfolgen, um die Sicherheit von Patienten, Anwendern und Dritten zu gewährleisten. Eine ordnungsgemäße Aufbereitung wird vermutet, wenn die KRINKO-BfArM-Empfehlungen eingehalten werden.
Nutzen für den Patienten
Infektionsprävention: Validierte Verfahren minimieren das Risiko nosokomialer Infektionen, die jährlich tausende Todesfälle verursachen.
Sicherheit und Funktionalität: Validierung stellt sicher, dass das Medizinprodukt nach wiederholter Aufbereitung frei von mikrobieller Kontamination ist und seine Funktion behält.
Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Dokumentierte Validierung schafft Vertrauen und Rechtssicherheit für Anwender und Patienten.
Risikobewertung durch den Hersteller
Normative Grundlage: DIN EN ISO 14971 (Risikomanagement für Medizinprodukte).
Ziele der Risikobewertung:
- Identifikation typischer Verunreinigungen (z.B: Blut, Proteine, Biofilm).
- Auswahl geeigneter Verfahren (manuell, maschinell, chemisch, thermisch).
- Festlegung von Akzeptanzkriterien (z. B. Restprotein < 6,4 µg/cm², Bioburden-Reduktion).
Pflichten des Herstellers:
- Bereitstellung einer validierten Aufbereitungsanweisung.
- Durchführung von Worst-Case-Analysen (z. B. schwer zugängliche Stellen, maximale Verschmutzung).
- Dokumentation und Nachweis der Wirksamkeit.
Probenvorbereitung und Prüfverfahren im Labor
Die Validierung der Aufbereitungsverfahren muss unter Bedingungen erfolgen, die den klinischen Einsatz möglichst realistisch simulieren. Dies betrifft sowohl die Art der Verschmutzung als auch die Prüfmethoden, die die Wirksamkeit der Reinigung und Desinfektion nachweisen.
Simulation realer Verschmutzungen
Die größte Herausforderung besteht darin, die typischen Verunreinigungen nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Medizinprodukts nachzubilden. Diese Simulation muss folgende Aspekte berücksichtigen:
- Art der Kontamination: Blut, Gewebe, Proteine, Fette, Biofilm, ggf. mikrobiologische Belastung (abhängig von der klinischen Anwendung).
- Worst-Case-Szenarien: Engstellen, komplexe Geometrien, schwer zugängliche Oberflächen, ggf. auch Materialien.
- Trocknungszeit: In der Praxis trocknen Verschmutzungen oft an, was die Reinigung erschwert.
Beispiel für eine realistische Simulation:
- Verwendung von Schafsblut oder synthetischer Prüfanschmutzung (z. B. Browne Soil) zur Nachbildung von Blut- und Proteinrückständen.
- Auftrag auf kritische Stellen des Produkts (z. B. Gelenke, Lumen), gemäß einer zu erwartenden realen Anschmutzung (oder einer Worst-case Variante davon).
- Antrocknen für z.B. 2 Stunden bei Raumtemperatur, um die klinische Realität zu simulieren.
- Anschließend: Durchführung des vom Hersteller angegebenen Reinigungs- und Desinfektionsverfahrens.
Typische Prüfverfahren und Zielsetzung
Die Prüfungen im Labor dienen dazu, die Wirksamkeit der Aufbereitung zu belegen. Sie lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen:
a) Chemische Prüfverfahren
- Proteinrückstände:
- BCA-Test (Bicinchoninic Acid): Quantifizierung von Restprotein in µg.
- TOC-Analyse (Total Organic Carbon): Erfassung organischer Rückstände (u.a. auch Reinigungsmittelrückstände).
- Zielsetzung: Nachweis, dass die Reinigung organische Kontaminationen entfernt und unterhalb von Grenzwerten bleibt (z. B. < 6,4 µg Protein pro cm² Medizinprodukt-Oberfläche).
b) Mikrobiologische Prüfverfahren
- Bioburden-Test: Bestimmung der Keimzahl vor und nach Reinigung (ISO 11737-1). Es müssen länderspezifische Vorgaben zur Keimzahl-Reduktion erreicht werden.
- Sterilprüfung (bei der Sterilisationsvalidierung): Prüfung auf Keimfreiheit
- Zielsetzung: Sicherstellen, dass Desinfektion und Sterilisation wirksam sind.
b) Material- und Funktionsprüfung (durch den Hersteller)
- Mechanische Tests: Prüfung von Gelenken, Schließmechanismen nach wiederholter Reinigung.
- Zielsetzung: Sicherstellen, dass das Produkt seine Funktion und Integrität behält.
Bewertung der Ergebnisse und Konsequenzen
Akzeptanzkriterien:
- Restprotein unter Grenzwert.
- Mikrobiologische Reduktion auf definiertes Niveau.
- Keine Materialschädigung.
Maßnahmen bei Nichterfüllung:
- Anpassung der Aufbereitungsanweisung.
- Auswahl alternativer Verfahren oder Chemikalien.
- Begrenzung der Lebensdauer des Produkts.
Dokumentation:
- Validierungsbericht als Nachweis für Behörden und Anwender.
- Revalidierung bei Änderungen am Produkt oder Verfahren.
Fazit
Die Validierung der Aufbereitungsverfahren ist ein gesetzlich vorgeschriebener und sicherheitsrelevanter Prozess. Sie schützt Patienten vor Infektionen, sichert die Funktionalität von Medizinprodukten und erfüllt regulatorische Anforderungen. Hersteller tragen die Verantwortung, durch Risikobewertung und Laborprüfungen die Wirksamkeit ihrer Anweisungen nachzuweisen.
Newsletter Anmeldung