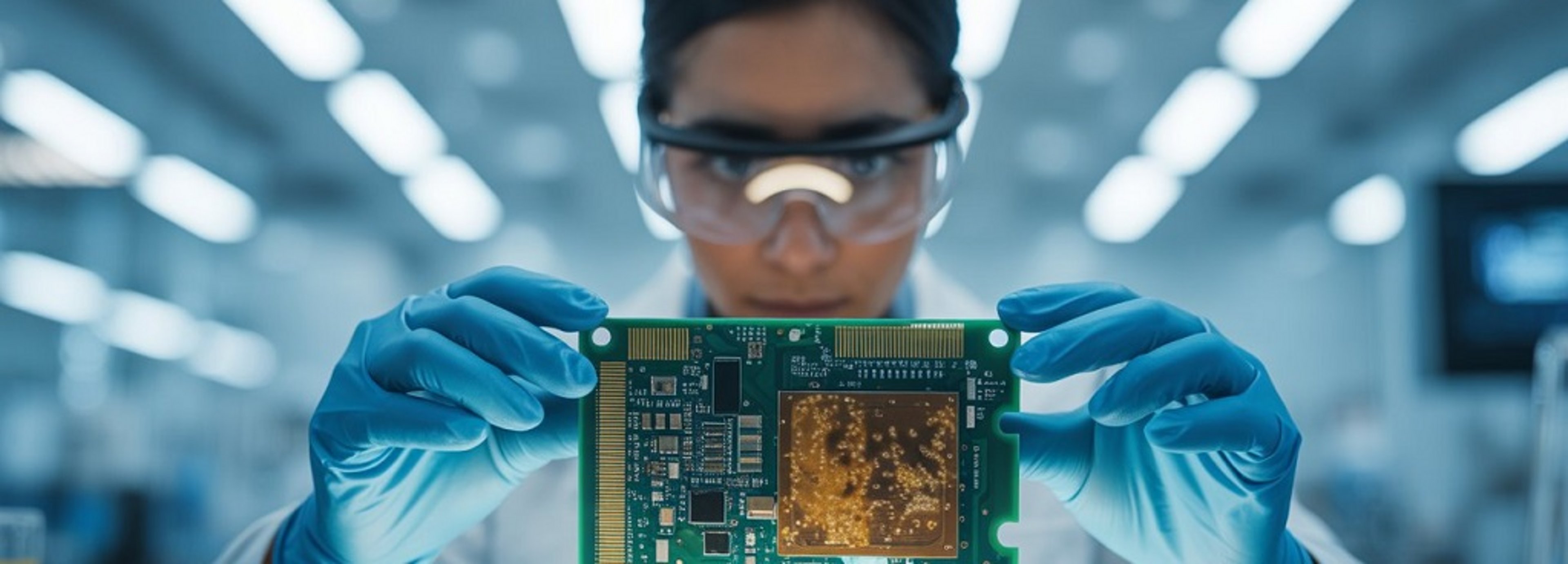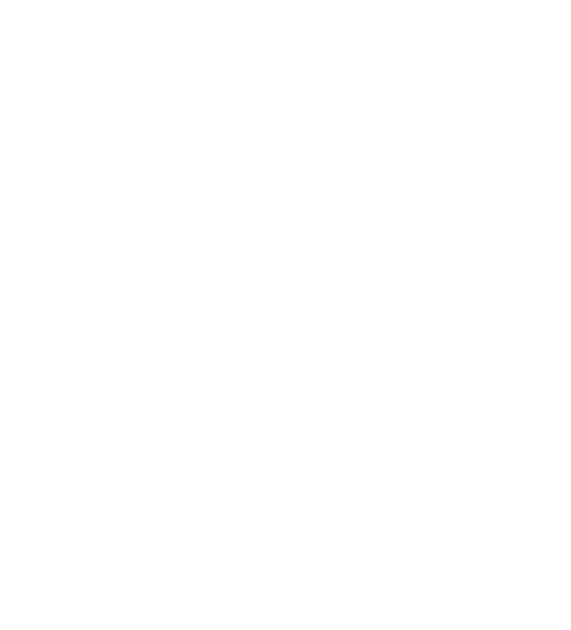Ionische Rückstände auf elektronischen Baugruppen
Was sind ionische Rückstände und welche Bedeutung haben diese?
Fällt das Smartphone zu Hause ins Waschbecken, stehen die Chancen gut, dass es nach dem Trocknen wieder funktioniert. Ist es hingegen ins Meer gefallen, sieht es trotz sorgfältiger Trocknung meistens nicht gut aus. Der Grund dafür ist das Salz im Meerwasser, dessen Spuren auf den elektronischen Baugruppen verbleiben und so zu Korrosion oder gar Kurzschlüssen führen.
Doch bereits während der Fertigung elektronischer Baugruppen wie Platinen (engl. printed circuit board – PCB) oder der bestückten Variante (engl. printed circuit board assembly – PCBA) kommt es zu einer ionischen Kontamination, beispielsweise durch Lötprozesse. In analoger Weise sind auch hier ionische Rückstände von kritischer Bedeutung, die es zu entfernen gilt, da sie bei Verbleib auf der Baugruppe zu einem verfrühten Ausfall führen können. Dies kann sich durch fehlerhaftes Verhalten der Steuerelektronik aufgrund zu hoher Leckströme zeigen oder direkt zu einem Defekt durch die langsame Bildung von Dendriten führen. In Extremfällen kann es sogar zu einem unmittelbaren Kurzschluss kommen. Es ist daher für die Zuverlässigkeit einer in Serie gefertigten elektronischen Baugruppe unabdinglich, zu überprüfen, ob ionische Rückstände erfolgreich auf ein akzeptables Maß minimiert wurden.
Zur Bestimmung ionischer Rückstände ist der ROSE-Test häufig das Mittel der Wahl. Im Folgenden zeigen wir den Nutzen und die Grenzen des Tests und stellen dessen sinnvollen Einsatzbereich dar.
ROSE-Test: Definition und Anwendung
Definition
Der ROSE-Test (Resistivity of Solvent Extract) ist eine vergleichsweise einfache Methode, mit der sich die ionische Kontamination in Form eines Summenparameters ermitteln lässt. Er ist normativ in IPC TM 650 2.3.25 für bestückte Platinen (PCBAs) bzw. in IPC TM 650 2.3.25.1 für unbestückte „Rohplatinen“ (bare PCBs) festgelegt. Dabei wird die Leitfähigkeit einer Lösung gemessen, die durch Extraktion der ionischen Kontamination von der Oberfläche der Baugruppe gewonnen wird. Der ausgegebene Wert (µg NaCl-Äquivalente/cm²) gibt die Gesamtheit der ionischen Kontamination wieder, ohne Hinweise auf deren Ursprung oder Zusammensetzung zu liefern. Der ausgegebene Wert ist so zu verstehen, dass die ermittelte Menge an Natriumchlorid (Kochsalz) pro cm² der beprobten Oberfläche des zu prüfenden Teils eine äquivalente Leitfähigkeit aufweist wie der durch die ionische Kontamination hervorgebrachte Wert.
Es ist also von elementarer Bedeutung, die korrekte Bauteiloberfläche in das Ergebnis einfließen zu lassen. Die Ermittlung der Oberfläche eines bare PCBs ist einfach: 2 x Länge x Breite. Die Ermittlung der Oberfläche einer einseitig bestückten Platine ohne CAD-Daten ist hingegen nicht trivial. Daher erlaubt die IPC TM 650 2.3.25 eine Formel zur Abschätzung der Gesamtoberfläche: 2 x Länge x Breite + 0,5 x Länge x Breite. Die zusätzliche „halbe, einseitige“ Fläche stellt also eine Art „Fudge-Faktor“ für die schwer zu bestimmende Oberfläche der aufgesetzten/gelöteten Komponenten dar.
Anwendung und Grenzwert
Generell ist der ROSE-Test jedoch weniger gut geeignet, um absolute und eigenständige Werte ohne Vergleich zu generieren. Er hat seine Stärken in der kontinuierlichen Prozessüberwachung, bei der unter gleichbleibenden Bedingungen zwei Teile unterschiedlichen Zustands direkt miteinander verglichen werden können.
Nichtsdestotrotz ist im Handbuch „Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies“ (IPC JSTD 001) ein Grenzwert von 1,56 µg/cm² zu finden, der häufig als Beurteilungskriterium herangezogen wird. In der Revision H aus dem Jahr 2020 wurde hingegen festgelegt, dass dieser Wert ohne objektiven Nachweis nicht mehr als qualifizierendes Maß für eine i. O. oder n. i. O. Bewertung herangezogen werden darf. Die Grenzwerte sollten daher im Kunden-Lieferanten-Verhältnis nach entsprechender Qualifizierung festgelegt werden. Eine solche qualifizierte Untersuchung ist der SIR-Test (engl.: Surface Insulation Resistance). Dabei werden die Widerstandswerte zwischen einer hohen Anzahl von Messpunkten auf dem PCB aufgezeichnet, während sich dieses in einer Klimakammer bei erhöhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit befindet. Durch die extremen Bedingungen werden Korrosionsprozesse gefördert und ionische Verunreinigungen werden mobilisiert. Dies führt zu einer Erhöhung der gemessenen Ströme zwischen den Messpunkten und somit zu einem Überschreiten eines für den Betrieb sicheren Wertes. Eine Platine in diesem Zustand ist also zu stark kontaminiert und der bei einer anschließenden ROSE-Messung erhaltene Wert ist als nicht in Ordnung (n. i. O.) zu bewerten. Somit liegt ein objektiver Nachweis für einen relevanten Grenzwert vor.
Für die interessierten Leser möchten wir an dieser Stelle auf diesen ausgezeichneten Beitrag zum Thema „Objective Evidence“ verweisen:
Ionenchromatographie: Die elementare Ergänzung
Um entsprechende Abstellmaßnahmen einleiten zu können, muss der Ursprung der ionischen Kontamination ausfindig gemacht werden. Hierfür ist der ROSE-Test gänzlich ungeeignet. Stattdessen bietet sich die Ionenchromatographie nach IPC TM 650 2.3.28 bzw. IPC TM 650 2.3.28.2 speziell für unbestückte Leiterplatten an. Auch hierbei wird die Kontamination vom Prüfteil extrahiert (statische Extraktion). Jedoch werden statt der Leitfähigkeit als Summenparameter die im Extrakt enthaltenen Ionen aufgetrennt (Stichwort: Chromatographie) und anhand ihrer spezifischen Retentionszeit charakterisiert sowie mittels Leitfähigkeitsdetektor quantifiziert.
Die IPC TM 650 2.3.28 enthält dabei eine umfangreiche Liste relevanter Kationen, Anionen sowie organischer Säuren. Eine Erweiterung um nicht gelistete, spezifische Ionen ist möglich. Das Ergebnis, also die Art und Konzentration des jeweiligen Ions, ermöglicht einen direkten Abgleich mit den Inhaltsstoffen der verwendeten Prozessmittel und somit die Einleitung von Abstellmaßnahmen innerhalb des Reinigungsprozesses.
Vorteile und Nachteile der Ionenchromatographie
Die bessere Reproduzierbarkeit ermöglicht einen besseren Vergleich zwischen unterschiedlichen Setups und Laboren. Die hohe Empfindlichkeit der Methode ermöglicht zudem eine ortsaufgelöste Extraktion der ionischen Kontamination an funktionskritischen Komponenten oder besonders auffälligen Stellen auf dem PCB(A). Dies kann insbesondere bei der Ursachenforschung der Kontaminationsquelle von großem Nutzen sein.
Möchte man die Ergebnisse der Ionenchromatographie als Bewertungskriterium für „i. O.” oder „n. i. O.” heranziehen, so müssen diese für jedes Ion bestimmt werden. Zustand heranziehen, so müssen diese für jedes Ion bestimmt werden. Auch hier muss eine Bewertung nach den oben genannten Kriterien der „objective evidence” erfolgen, bevor Grenzwerte definiert werden können.
Der Mehrgehalt an Informationen steht jedoch im Kontrast zum höheren Aufwand in technischer, zeitlicher, finanzieller und personeller Hinsicht im Vergleich zu einer ROSE-Messung.
Die C3 Methode von Foresite, Inc.
(Nicht im Leistungsumfang von CleanControlling)
Die C3-Methode von Foresite, Inc. stellt einen Mittelweg dar, der eine automatische Vermessung der lokalen ionischen Kontamination über einen Summenparameter ermöglicht. Zwar erhält man keine Informationen über die stoffliche Zusammensetzung der Kontamination, jedoch kann eine ortsaufgelöste Messung schnell und zielführend Ausfälle an speziellen Stellen der Baugruppe untersuchen.
Die Vor- und Nachteile des ROSE-Tests im Überblick
| ➕ Vorteile | ➖ Nachteile |
|---|---|
| Einfache und schnelle Durchführung | Keine Aussage über Art oder Herkunft der Kontamination |
| Kostengünstig im Vergleich zu anderen Methoden | Nur ein Summenparameter – keine Differenzierung einzelner Ionen |
| Gut geeignet für die Prozessüberwachung unter konstanten Bedingungen | Geringe Aussagekraft bei Einzelmessungen ohne Vergleichsreferenz |
| Normativ verankert (z. B. IPC TM 650 2.3.25) | Oberflächenabschätzung bei bestückten Baugruppen ungenau ohne CAD-Daten |
| Kann als Monitoring-Tool zur Qualitätskontrolle eingesetzt werden | Grenzwerte dürfen ohne „objective evidence“ nicht pauschal verwendet werden |
| Schnelle Bewertung von „i.O.“ oder „n.i.O.“ bei bekannten Referenzwerten | Keine ortsaufgelöste Analyse möglich |
Fazit
Der ROSE-Test ist ein wertvolles Monitoring-Tool zur Bestimmung der ionischen Kontamination auf Leiterplatten und Baugruppen. Die Ermittlung fixer Werte bei gleichzeitiger Vergleichbarkeit zwischen beispielsweise unterschiedlichen Geräten ist hingegen keine Stärke der Technik. Es müssen daher stets bauteilabhängige Grenzwerte ermittelt werden, die nach dem Verfahren der „objective evidence” ermittelt wurden. Für eine detaillierte Analyse und Ursachenforschung ist die Ionenchromatographie das bevorzugte Verfahren.
CleanControlling bietet sowohl die ROSE-Messung nach IPC TM 650 2.3.2. als auch die Untersuchung via Ionenchromatographie nach IPC TM 650 2.3.28. sowie nach einschlägigen Normen aus dem Automobilbereich an.
Newsletter Anmeldung